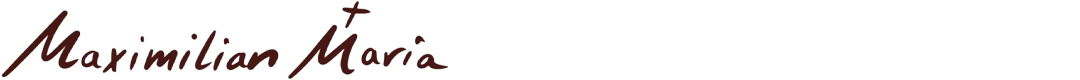1. Rituale um den Esstisch
Wenn wir uns zum Essen und Trinken versammeln, umgeben wir es mit Ritualen: Die Hände waschen, sich zu Tisch begeben, einander einen ›Guten Appetit‹ wünschen usf. Wer an Gott glaubt, macht vielleicht ein Kreuzzeichen oder spricht ein Tischgebet. Selbst der gottlose Gollum sagt sich vor dem Essen einen Reim auf:
›Auf den Tisch kommt heut ein Fisch‹.
Manche Rituale erscheinen heute unverständlich, vor allem religiöse. Sich rituell waschen? Wegen welcher Unreinheit? – Ein Dankgebet sprechen? Warum, wenn doch Überfluss herrscht? Und: wem danken? – Erntedank feiern? Wer erntet denn heute noch selbst?
Esskultur(en) heute
Wie in anderen Lebensbereichen, gibt es auch beim Essen und Trinken heute keine Monokultur mehr, sondern viele Esskulturen existieren postmodern plural nebeneinander: vom ›schnell-schnell‹ (Fastfood, Mikrowelle, Lieferservice) über den Veggieday (zelebriert oder bloß in Kauf genommen), bis hin zu ›slow food‹.
Frühstück, Mittag- und Abendessen bleiben vielleicht kulturelle Pfeiler, aber ob ›wie Bettler, König, Kaiser‹, ob allein oder gemeinsam, ob hastig oder ausgiebig – das entscheidet jeder Haushalt für sich.
Die Lage ist unübersichtlich: Noch nie war die Ernährung so gut erforscht und noch nie war so schwierig, sich zwischen den Diäten, Nahrungsergänzungsmitteln und Ernährungsphilosophien zurechtzufinden, die sich zudem nicht selten als alleiniger Weg zur kulinarischen Selbstfindung oder gar ganzheitlichen Gesundheit inszenieren.
Neben den regelmäßig neu aufgewärmten Diäten tauchen auch ganz neue Tischrituale auf, besonders interessant: das Fotografieren von Essen.
2. Essen fotografieren
Heute wird vor dem Essen oft nicht gebetet, sondern fotografiert. Die Darstellung von Essen ist nichts Neues: Schon vor dem Smartphone wurden Speisen und Getränke inszeniert und künstlerisch dargestellt, etwa im Stillleben.
Auch das Fotografieren von Essen dürfte also zunächst einfach dem ästhetischen Vergnügen entsprechen, etwas zu kochen, essen zu gehen und sich darüber auszutauschen. Doch scheinen mir auch tiefere Gründe vorzuliegen, warum Menschen ihr Essen fotografieren.
Dazu drei Gedanken:
a) Nähe zum Selfie 📱
Neben dem Essen fotografieren wir bekanntlich am liebsten uns selbst. Wie das Selfie-Subjekt versucht, digital ›relevant‹, also am Leben zu bleiben, sendet auch das Fotografieren von Nahrungsmitteln eine Botschaft gegen das eigene Verschwinden: ›Schaut, ich erhalte mich am am Leben. Ich esse, also bin ich.‹
Das mag albern klingen, doch sind Selfies sonst auch nichts anderes als die unaufgeforderte Mitteilung: ›Schaut, ich existiere. Ich bin (noch) da und tue Dinge.‹1
b) Leben in Fülle 🍱
Nicht nur, dass ich lebe, sondern auch, dass ich ein Leben in Fülle habe, kann ich durch den vollen Teller mitteilen. Es hätte sich auch der Trend herausbilden können, seinen leergegessenen Teller zu fotografieren, oder ein Vorher-Nachher-Bild zu posten, im Sinne von ›Leute, das war gut‹.
Doch nur der volle Teller an sich, zweckfrei, unangerührt, mit der Möglichkeit zur Verschwendung, inszeniert die reine Verfügbarkeit. (Zumal viel fotografiertes Essen wohl nie in einem Magen, sondern in der Tonne landet. ›Food porn‹ wirft einen ebenso lieblosen Blick auf die Speisen wie reguläre Pornografie auf die Menschen.)
c) Gegen die Einsamkeit 🍽️
Wer einmal als Single gewohnt und gekocht hat (heute ja die zunehmende Zahl der Haushalte), kennt das Gefühl, sich zum Essen etwas ›reinziehen‹ zu wollen, wie eine Serie (wobei die Suche nach der perfekten Folge mitunter das Essen kalt werden lässt).
So wie die bekannten Gesichter der Seriencharaktere ein Familienersatz sein können, kann auch das ›Teilen‹ von Bildern eine Kompensation dafür sein, dass gerade niemand zum Teilen da ist oder man ›gemeinsam einsam‹ dasitzt, jeder mehr mit seinem Smartphone beschäftigt als mit dem Gegenüber.
Die zutiefst menschliche Sehnsucht nach Mahlgemeinschaft drückt sich darin aus. Sein Essen zu fotografieren, ist also eine verständliche Sache. Fragen wir uns zum Schluss, ob es Rituale um das Essen gibt, die dieser Sehnsucht vielleicht besser entsprechen.
3. Mahlgemeinschaft
Ein Mahl ist die gemeinsame Einnahme von Speisen und Getränken. Neben der Sättigung erfüllen Mähler auch soziale, religiöse und psychologische Funktionen.2
Mehr als nur Futtern
Festliche Mähler markieren oft große Momente im Leben: von der Hochzeitstorte, bis hin zum ›Leichenschmaus‹. Das gemeinsame Essen scheint tief in unserer Evolution verwurzelt zu sein, als Zeichen: ›Wir sind füreinander da; wir wollen uns Gutes; wir teilen das Leben miteinander‹.
Von einer Einrichtung, die verlassene Waisenkinder aufnimmt, habe ich gehört, dass das gemeinsame, ritualisierte Abendessen der wichtigste Aspekt der ganzen Begegnung ist, weil es den Kindern Struktur und Vertrauen ermöglicht.
Erst das gemeinsame Essen ist wirklich Leben in Fülle. Darum kann das Festmahl auch als Bild für den Himmel dienen (es könnte ja auch eine ewige Konferenz sein). Bereits im Alltag lässt uns das Essen jenes Fest erahnen, zu dem wir geladen sind.
Blumig, doch zutreffend, drückt es der Theologe Karl Rahner aus:
»Es [das Essen] ist das Fest im Alltag. Denn es kündet von der Einheit, in die hinein sich alles und alle bergen wollen und in der alle bewahrt und aus ihrer Einsamkeit befreit werden, es spricht im Alltag leise, aber doch vernehmbar, vom Gastmahl des ewigen Lebens.«3
Und für die Einsamen?
Regeln für sich selbst
Bis zum himmlischen Mahl, werden wir noch oft allein etwas zu uns nehmen, und nicht jeder Imbiss wird uns an den Himmel erinnern. Wer an Einsamkeit leidet, wird vielleicht kaum mehr Lust zum Kochen oder Essen verspüren.
In der Endphase meines Studiums habe ich alleine in einer Wohnung gelebt und bin heute sehr dankbar, dass wir im Orden gemeinsam essen.
Für das Essen allein scheinen mir besonders drei Punkte hilfreich:
Routine: Das Wort Mahl-Zeit verrät schon, dass Mahlzeiten meist zu festgesetzten Zeiten eingenommen werden. Sofern es also die Arbeitszeiten zulassen, auf seine biologische Uhr hören.
Back to the basics: Was die Unübersichtlichkeit der Ernährungsratgeber angeht, sich an einfache Grundregeln halten, die auch bei Ernährungstrends unverändert bleiben: möglichst mehr Unverpacktes als Fertigprodukte kaufen, konsequent Wasser statt Softdrinks trinken usf.
Das rechte Maß: sich nicht durch Zu-viel überfressen und nicht durch Zu-wenig zu einem entkräfteten Bündel aus Energielosigkeit werden.
Ein interessanter Essenstipp ist der Vorschlag des hl. Ignatius von Loyola, so zu essen, wie Christus essen würde (vgl. EB, Nr. 214). Dazu gehört auch das Tischgebet.
Dankbar genießen: das Tischgebet
Im Tischgebet betrachten wir die Speisen und Getränke als Gabe. Wir nehmen sie nicht selbstverständlich hin, sondern danken Gott, unserer Erde und den Menschen, die sie uns zubereitet haben.4
Aus der Glücksforschung ist bekannt, dass Dankbarkeit einen der wichtigsten Bausteine für ein glückliches Leben bildet, in der Fülle wie in der Leere. Und sie erinnert uns daran, dass nicht viel braucht, um Glück zu erleben: etwas Leckeres zu essen, Freunde, mit denen man es teilen kann, gute Gespräche, Gemeinschaft.
Auch für mich allein kann ich mich in Dankbarkeit und Gemeinschaft ›einklinken‹, und sei es nur durch ein einfaches Kreuzeichen vor dem Frühstück, das ich in Stille genieße. Denn auch ganz ohne Fotobeweis, weiß Gott, wo ich sitze oder stehe, und deckt mir, deckt uns, schon den Tisch für das Fest, das vor uns liegt.
Das nächste Mal werden betrachten, was passiert, wenn das Essen nicht nur zum Fotomotiv, sondern zum Götzen erhoben wird: nämlich die Völlerei.
Gottes Segen und bis nächste Woche,
Vgl. (etwas kulturpessimistisch) Han, Byung-Chul, Die Errettung des Schönen, Frankfurt a. M.: Fischer (4. Aufl.) 2016, S. 22f: »Angesichts der inneren Leere versucht das Selfie-Subjekt vergeblich, sich zu produzieren. […] Nicht eine narzisstische Selbstverliebtheit oder Eitelkeit, sondern eine innere Leere generiert die Selfie-Sucht. Es gibt hier kein stabiles, narzisstisches Ich, das sich selbst lieben würde. Vielmehr haben wir es mit einem negativen Narzissmus zu tun.«
Zahlreiche biblische Beispiele und Belegstellen für die drei Dimensionen der Mahls (sozial, religiös, psychologisch) gibt Weißflog, Kay, Art.: »Mahl/Mahlzeit (AT)«, in: WiBiLex 2010 <http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/25346/>
Rahner, Karl, Alltägliche Dinge, Einsiedeln: Benziger (6. Aufl.) 1966 [Theologische Meditationen 5], S. 23.
Schon im Alten Testament galten grundsätzlich galten alle Lebens- und Nahrungsmittel als Gottesgabe (vgl. Dtn 12,15f.; Dtn 32,13; Ps 104,10-15.27f.; Pred 2,24; Pred 3,13; Hos 2,10f.; Hos 11,4).